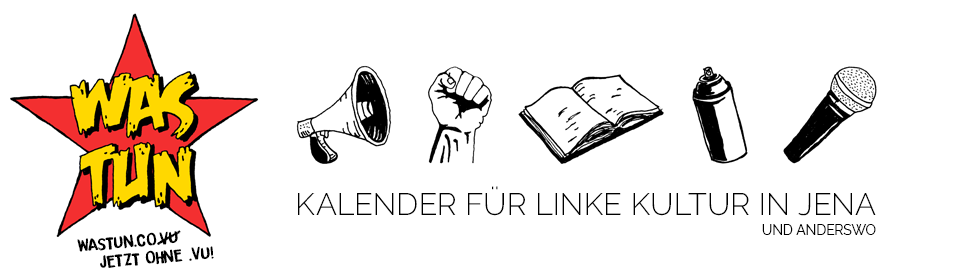17. August 2016 | 19:30
Vortrag von PD Dr. Annegret Schüle, ergänzt durch einen Kurz-Dokumentarfilm
Nach dem Ersten Weltkrieg gewann für kurze Zeit eine oppositionelle Strömung in der deutschen Arbeiterbewegung an Bedeutung, die eine revolutionäre Grundhaltung mit striktem Antizentralismus verband: der Anarchosyndikalismus. Die in der Freien Arbeiter-Union Deutschland (FAUD) organisierte Bewegung erreichte im Jahre 1921 die höchste Mitgliederzahl mit 150.000, bis zum Ende der 20er Jahre schrumpfte sie jedoch wieder auf unter 10.000 Mitglieder. Nach 1933 teilten die Anarchosyndikalisten das Verfolgungsschicksal aller antifaschistischen Gruppen. Die DDR löschte die Erinnerung an diese Strömung in der Arbeiterbewegung aus.
Der Anarchosyndikalismus wollte die Abschaffung des Kapitalismus als System der „rücksichtslosen Ausbeutung der breiten Massen zugunsten einer kleinen Minderheit Besitzender“, wie es in der von Rudolf Rocker formulierten „Prinzipienerklärung des Syndikalismus“ von 1919 hieß. Die FAUD lehnte jede Form der Zentralisierung, insbesondere in politischen Parteien und durch staatliche Strukturen, ab. Sozialdemokratischen und kommunistischen Parteien sowie den Gewerkschaften warf man vor, in ihren Hierarchien und Kampfformen die herrschenden Verhältnisse zu imitieren oder sie seitenverkehrt widerzuspiegeln. Die Anarchosyndikalisten setzten auf die „direkte Aktion“, insbesondere den Generalstreik, der unter Verzicht auf Gewaltanwendung Unternehmern wie staatlichen Institutionen die Macht entziehen und die Arbeiterkontrolle verwirklichen sollte. In der neuen Gesellschaft des herrschaftslosen Sozialismus würden die Menschen dann in selbstverwalteten Betrieben und Verteilzentren die Produktion und den Konsum nach ihren Bedürfnissen regeln.
Auch wenn der Schwerpunkt der FAUD im Ruhrgebiet lag, hatte sie auch in Thüringen Anhänger und wurde in Sömmerda für einige Jahre sogar zur dominierenden Kraft in der lokalen Arbeiterbewegung. Im Vortrag von Annegret Schüle wird diese außergewöhnliche Entwicklung in der Kleinstadt nördlich von Erfurt nachgezeichnet und in den Kontext der Stadtgeschichte gestellt. Diese wurde von dem großen Rüstungsunternehmen Rheinmetall dominiert, dessen Belegschaft im Ersten Weltkrieg auf 10.000 Arbeitskräfte angewachsen war. Warum gelang es gerade in Sömmerda, die Beschäftigten eines Großbetriebes geschlossen für diese neue politische Strömung zu gewinnen? Wie wurde die strikte antimilitaristische Orientierung der FAUD im Werk umgesetzt? Was geschah im Kapp-Putsch und wie wurden Lohnkämpfe geführt?
PD Dr. Annegret Schüle promovierte an der Universität Jena über weibliche Arbeitserfahrungen in einem Textilbetrieb der DDR und habilitierte an der Universität Erfurt mit der Monografie „Industrie und Holocaust. Topf & Söhne – Die Ofenbauer von Auschwitz“. Sie ist außerdem Autorin einer Werksgeschichte über das Büromaschinenwerk Sömmerda und zahlreicher Aufsätze. Seit 2011 leitet sie den von ihr konzipierten Erinnerungsort Topf & Söhne – Die Ofenbauer von Auschwitz, ein Geschichtsmuseum der Landeshauptstadt Erfurt.