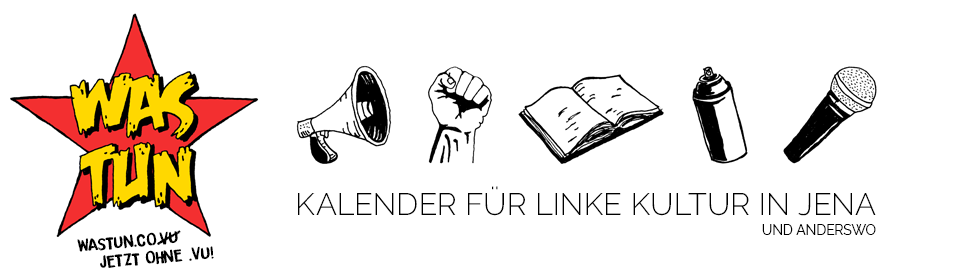28. November 2015 | 19:00
Photographien wirken. Je drastischer die Szenen ausfallen, desto stärker stoßen diese Bilder auf uns ein und schockieren. Aber es gibt zugleich Grenzen, was zu zeigen ist und was nicht mehr geht, weil (vorgebliche) Moral und Zumutbares überschritten sind. Zudem werden im Strom der sich überbietenden, täglich wechselnden Bilder, Motive und Anlässe schnell von neuen Schock-Szenen abgelöst. Die Photographien der an den Strand gespülten toten Kinder aus dem Mittelmeer gingen Anfang September einige Tage durch die Presse – und wurden dann wieder vergessen. Neue Bilder kamen. Das Grauenhafte im Bild löst sich inflationär auf. Zuviel des Schocks erzeugt ab einem bestimmten Punkt paradoxerweise den gegenteiligen Effekt.
Liegt im Akt des Betrachtens bereits eine Distanzierung? Und wie verhält es sich mit den theoretischen Reflexionen, in denen wir Bilder in eine Sprache der Theorie überführen und damit bereits eine Grenze erreichten? Selbst eine rein phänomenologisch-beschreibende Sichtung setzt zwischen die Photographie und die Betrachter einen Abstand: nämlich den der (unaufhebbaren) Wort-Sprache. Vielleicht aber ist genau dieser Abstand samt der Reflexion darauf das, was ein Bild überhaupt erst zur Entfaltung bringt, um Leiderfahrung von und vor Menschen anschaulich werden zu lassen. Diese Weisen des Sichtbarmachens sowohl von Leiden wie auch die Modalitäten von Referenz stellen zugleich die Frage nach der ästhetisch Form eines Bildes und damit die Frage nach dem Realismus von Bildern. Wie kann und darf, wie soll ein Bild beschaffen sein? „Die Absurdität des Realen drängt auf eine Form, welche die realistische Fassade zerschlägt.“ So Adorno in bezug auf die Kunst.
Photographien können als Dokumente arbeiten und wirken. Kunstwerke jedoch entziehen sich einem solchen unidirektionalen Abbildrealismus, weil er allzuleicht in den Kitsch der guten Gesinnung umschlägt. Dennoch veranschaulichen auch solche Werke der bildendenden Kunst auf ihre Weise das Grauenhafte. Dieses Verhältnis von dokumentarischer und künstlerischer Bildlichkeit möchte der Vortrag ausloten. Fokussieren will ich auf die Bilder von den toten Kindern. Was darf Photographie? Wie weit geht sie und inwiefern sind Photographien zugleich ein Distanzmedium? Ganz anders als etwa ein Kunstwerk es sein kann. Diese Fragen berühren ebenso jenen zentralen Satz von Adorno, den er später freilich modifizierte, daß es barbarisch sei, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben. Insbesondere im Blick auf die Ästhetik Adornos und auch hinsichtlich der Photographie bleibt diese Frage nach wie vor aktuell: Wie nämlich Leiden darzustellen sei und inwiefern Kunst gleichzeitig zur Ästhetisierung dieses Leidens beiträgt.
mehr unter: bersarin.wordpress.com