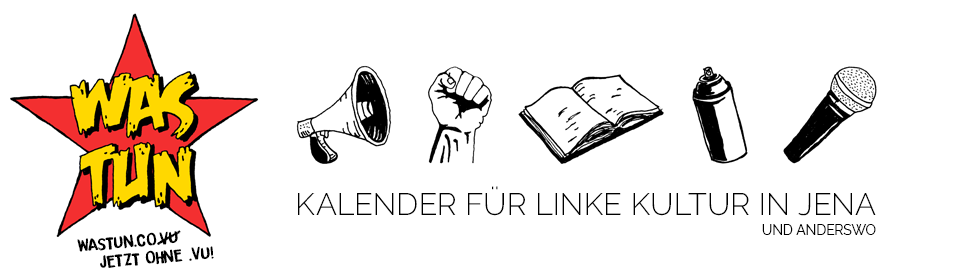27. Januar 2016 | 18:00
arxsche Kategorien wie Verdinglichung und Warenfetisch erfahren bei Adorno und dem frühen Lukács eine einschneidende Umdeutung, die von der romantischen Kultur- und Zivilisationskritik ihrer Zeit inspiriert ist. Während sie bei Marx noch als ideologische Formen erscheinen, die die Arbeiterklasse daran hindern, sich als Objekt der Ausbeutung einer anderen Klasse zu begreifen, wird der Schein des Kapitals als „automatischem Subjekt“ in der Kritischen Theorie zur grauenerregenden Fiktion einer subjektlosen Welt. In dieser seien selbst die Herrschenden bloß noch „Funktion ihrer Funktion“. Da der Klassenkampf so jeden möglichen Adressaten verliert, tritt an seine Stelle die sich selbst von vornherein für hoffnungslos erklärende Ethik individueller Weigerung, der leere Gestus des irgendwie Nichteinverstandenseins. Die Kritische Theorie zieht damit weniger die Konsequenzen aus dem Scheitern der revolutionären Arbeiterbewegung, sondern gibt verbreiteten lebensphilosophischen
Themen der damaligen Jugendbewegung durch ihre Projektion auf den Marxismus einen neuen, scheinbar besonders radikalen Anstrich. Einen jedoch, der die für Marx zentralen Fragen, wie die nach Armut, Herrschaft und ökonomischer Fremdbestimmung, systematisch in der Versenkung verschwinden lässt.
Referent: Georg Klauda (freier Autor, Berlin)